|
| |
|
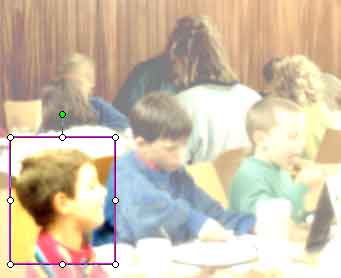 |
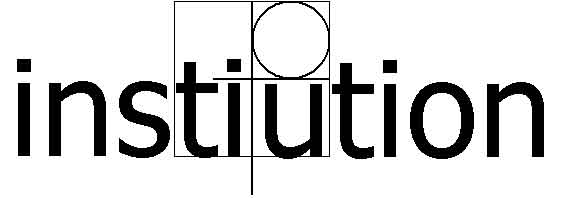 |
|
|
|

|
Der dritte Begriff, Institution,
versucht, das unspezifischste der Systeme zu erfassen, die an der
Fremdunterbringung von Kindern beteiligt sind. Es kann nicht unabhängig
von den beiden vorstehend beschriebenen verstanden werden, denn es ist die
Negation der Familie und die Manifestation der Fürsorge.
Ich habe Fürsorge dem Wesen nach als Struktur dargestellt, welche in
gesellschaftlichem Auftrag stellvertretenden Normenvollzug garantiert. In
ihren angedeuteten Konditionen ist sie allerdings bereits als Institution
gegenwärtig. Die Unterscheidung von Fürsorge und Institution
ist dennoch sinnvoll, insofern erstere ein intendierter gesellschaftlicher
Ausdruck ist, zweitere eine abgeleitete Hypostasierung. Wen oder was immer
man unter Gesellschaft verstehen mag - die "volonté générale"
Rousseaus, Staatsverfassung,
Gesetze oder einfach eine Versammlung von Menschen unter einem beliebigen
Zeichen -, in ihren Konventionen ist sie ein negativer Begriff der
individuellen Freiheit. Sie vermag an die Stelle des Individuums nichts
Neues zu setzen. Ihr Auftrag ist folglich stets eine Ausgrenzung: Verbot
von Verhältnissen, die Bestrafung des Verhaltens, das ihrer Konvention,
dem Gemeinen der Gemeinschaft, widerspricht. Das Kriterium
der Gesellschaft ist das Ungenügen ihrer Mitglieder. Fürsorge beginnt in
sozialem Auftrag, wo das Versagen der Sorge des Einzelnen konstatiert
wird. Wie Fürsorge geschieht, ist nicht unmittelbarer Bestandteil
des Auftrags. Die Institution wird mittelbar gefolgert. Sie ist, obschon
eine Konsequenz ihrer Forderungen, nicht logischerweise in der
Gesellschaft, sondern weil ihr wie dem Individuum der Ausschluss droht.
Als 'Fleisch' am Skelett des Fürsorgegedankens muss auch sie für ihre
Konstitution den Preis der Konventionalität bezahlen. Sie ist die Nicht-Familie,
die wie die Familie darum kämpft, den Ansprüchen der Gesellschaft
zu genügen.
|
| Ob
Heim oder Pflegefamilie im Falle der Fremdunterbringung, - auch die
Institution kann scheitern. Doch die Kriterien dieses Scheitern sind
andere als die der Familie. Wie für die Fürsorge festgestellt, nimmt ihr
Funktionieren das Kind als Bedingung aus. Das scheint zunächst sinnvoll,
weil nicht anzunehmen ist, dass ein Verhalten, wie es beispielsweise
Niklas zeigt (sei es der Grund der Heimunterbringung oder nicht), sich außerhalb
der Familie schlagartig verändern wird. Tatsächlich jedoch identifiziert
dieser Ausschluss nachgerade das Kind als das eigentliche Problem. Bis
heute billigt die Gesellschaft fast jeden elterlichen Erziehungsstil,
solange das Kind späterhin zu einem Bekenntnis zu ihren Konventionen
kommt. Dass Prügel im familiären Rahmen vor gesellschaftlicher Ächtung
und gesetzlichem Verbot stehen, hat wenig mit Humanität zu tun; in einer
hochkomplexen Welt, die maximalen Selbstzwang verlangt, haben geschlagene
Kinder oft nicht die Motivation, die Kraft und die Kenntnis, die
Spielregeln der Gemeinschaft einzuhalten. |
Die
Nachdenklichkeit ist ein Teil seines
Charakters, seit er vor langer Zeit, als er noch
jung war, in dem neuen Staatsgefängnis bei
Horsens eingesperrt worden war und hier ein
Jahr in völliger Isolation gelebt hatte.
Das nach dem amerikanischen
Philadelphia-Prinzip gebaute Gefängnis war zu
dem Zeitpunkt noch nicht fertig, und wenn Ramses
aus einem der Kopenhagener Verbesserungshäuser
dorthin verlegt wurde, so deshalb,
weil der Gefängnisdirektor sich danach sehnte,
seine Prinzipien in die Wirklichkeit umzusetzen.
Peter
Hoeg
Vorstellung vom zwanzigsten Jahrhundert
rororo (1994) S.93
|
|
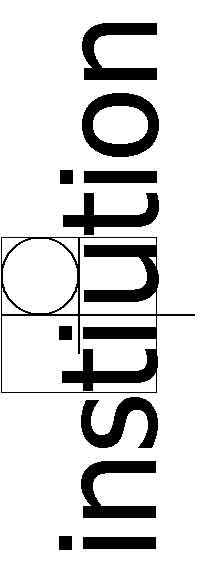
|
Umgekehrt
wird die Institution nach ihren Handlungen - dem Fürsorgevollzug - und
nicht nach den Ergebnissen beurteilt. Man kann die Quadratmeterzahl
Privatsphäre bestimmen, die ein Kind zum Leben brauchen mag, die
Ausstattung des Heims oder Anforderungen an Pflegefamilien, die Zahl der
anwesenden Betreuer, inwieweit das Kind der Schulpflicht genügt, seine
Freizeit und -räume auf Legalität kontrollieren. Ob es glücklich oder
wenigstens zufrieden ist, ob in der Quantifizierung von Lebensbedingungen
auch Lebensqualität entsteht, welchen Einfluss das fürsorgliche Bemühen
auf die Zukunft des Kindes hat, - dafür gibt es kein festes Maß. Gäbe
es dieses Kriterium, so würde gegen das Ungenügen der Institution noch
immer das festgeschriebene Scheitern der Familie stehen. Ein Kind, dem die
Institution nicht helfen kann, bleibt das Kind der Familie. Das
Nichtfunktionieren der Familie ist ja die Bedingung der Hilfe, Fürsorge
das Ausfüllen ihrer Defizienz. Ihre Konditionen sind primär, und vom
ersten Moment der Fürsorge an bleiben sie eingebrannt in den Köpfen der
Sozialarbeiter, Psychologen und Ärzte, notiert und fotografiert in den
Akten, den Beschreibungen eines Sorgezustands, der nicht länger andauern
soll. |
|
Solange
das Kind sich in Händen der Institution befindet, kann sich die Familie
vom Makel ihrer 'Ent-Sorgung' nicht befreien. Institutionalisierte
Kontakte zur 'Restfamilie', partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den
Eltern und ihr bleibendes Sorgerecht sind sinnvolle Maßnahmen, doch sie
verdecken das Scheitern der Familie nicht. Im Gegenteil: Ein Wochenende
oder Urlaub bei Eltern und Geschwistern ist kein Familienleben; die
Zusammenarbeit zwischen Eltern und Mitarbeitern von Fürsorgeinstitutionen
ist gerade Zeugnis eines Rechts- und Kompetenzgefälles, das in eine
Pseudopartnerschaft zu hüllen eine Beleidigung der elterlichen
Wahrnehmung bedeuten kann; schließlich erscheint das Verbleiben des
Sorgerechts bei den Eltern oft genug als Gnade gegen Kooperation, als missbrauchte
Macht über das Kind oder Entscheidungsqual für die Berechtigten, die für
eine Farce konditionierter Wahl das schmerzhafte Bewusstsein alleiniger
Verantwortung und Schuld tragen müssen! Kommt es eines Tages dennoch zu
einer Rückführung des Kindes in die Familie, ist sie eine andere
geworden. Dies nicht nur, weil sich ihre und die Konditionen für das Kind
(als Rückkehrbedingung in der Regel zum 'Bessern') verändert haben,
sondern weil ihr Scheitern ihre Geschichte geworden ist. Das Stigma muss
nicht notwendigerweise wirksam sein. Meistens aber ist es Kondition als
Selbstzweifel: Ich bekam Hilfe, doch brauchte ich sie nicht
auch?! In einem Zirkelschluss scheint mir die Fürsorge die
Richtigkeit meiner Idee von der 'besseren' Familie zu beweisen, obschon
doch die Fürsorge sich in Wirklichkeit auf einen kontingenten
Familienbegriff beruft. |

|
|
Meine
diesbezüglichen Gedanken verändern die Welt nicht. Ich sage nicht, dass
ein Kind sich in Heim oder Pflegefamilie nicht wohler fühlen kann als in
'seiner' Familie; dass Fürsorge mangelhafte Sorge nicht sinnvoll zu
kompensieren vermag; dass die Familie durch institutionelle Hilfe nicht
gewinnen kann, was immer sie oder die Gesellschaft unter einem solchen
Gewinn verstehen. Doch eine letzte Rechtfertigung erwächst aus den mutmaßlich
objektiven Verhältnissen nicht. Ich bin doch selbst ein Teil dieser
Systeme. Ich komme aus einer Familie, die ich anders denken kann,
als sie tatsächlich für mich war. Ich musste die Regeln der Gesellschaft
lernen, mich zu ihren Konventionen bekennen, bedroht durch die Möglichkeit
der Fürsorge. Ich habe die Institution gesehen, ihre
Abgrenzung von der Familie verstanden. Wie könnte ich jemals noch sagen, dass
'besser' ist, was nur hat sein können, solange ich nicht davon wusste?!
|
 |
Graf*
hat in seinen Betrachtungen über die "Grenzen der Einrichtung [= Institution]
als pädagogische Grenzen" etwas sehr Kluges festgestellt. Bezogen
auf die Kontrolle von Kindern und Jugendlichen in Fürsorgeinstitutionen
schreibt er: "Die Wahrnehmung ihrer eigenen Peripherie dient hier der
Einrichtung der Aufrechterhaltung ihres Einflusses auf den Insassen unter
dem Vorwand der Ausdünnung ihrer Aktivitäten." Zu Beginn der Maßnahme
ist die Kontrolle der Klienten sehr stark, da sich die Maßnahme durch den
Betreuungsbedarf legitimiert. Obschon - wie gezeigt - Verfassung und
Verhalten des Klienten kein Kriterium für das Funktionieren der
Institution sind, bleibt das Ziel der Maßnahme ein Zustand, der sie nicht
mehr bedingt. Mit der Zeit müsste die Kontrolle entsprechend abnehmen,
eine sukzessive Entfernung des Klienten aus dem Zentrum der Institution
stattfinden. Der Legitimationsbedarf der Institution wird jedoch nicht
geringer.
|
| Um
diesem Dilemma zu entgehen, das mithin auch finanzielle Aspekte wie temporär
überflüssige Betreuungsressourcen hat, nimmt die Institution zu sich
selbst eine Metaposition ein. Aus ihr heraus erklärt sie ihren faktischen
Rückzug zum Programm, in dem sie ihre Anwesenheit beim Klienten auf höherer
Ebene rechtfertigt und beibehält. Überspitzt formuliert heißt das: Der
Klient kann sich von der Institution nur lösen, wenn sie ihn
nicht mehr braucht. Das gleiche gilt für die denkbare Neukonstitution der
Familie, - von einer Restitution kann ja nicht gesprochen werden. Das
Stigma der Fürsorge liegt also nicht allein im festgeschriebenen
Augenblick des Scheiterns, sozusagen der sanktionierten größten Not der
Familie. Es dehnt sich aus. Es ist der fortwährende Blick der Institution
- und in ihm der Gesellschaft - auf das, was einmal die Familie war. |
Anna
sagte es niemandem, aber sie wusste, dass
das Wort Mission wichtig war. Die Deliranten
und die Frauenmisshandler und die Händler,
die alles, absolut alles, verkauften, sie alle meinten,
sie hätten eine Mission, es gab in diesem Gebäude
nicht einen Menschen, der nicht an der Verbesserung
der Gesellschaft arbeitete. Selbst diejenigen,
die einen scheuen Unwillen gegen eine
regelmäßige Arbeit hegten und ihr ganzes Leben
der Bekämpfung der Polizei gewidmet hatten
und in den Toreinfahrten mit in Zeitungspapier
eingewickelten Bleirohren warteten, waren
überzeugt davon, dass es möglich sei, sich in ein
besseres Dasein hineinzuprügeln [...].
Peter
Hoeg
Vorstellung vom zwanzigsten Jahrhundert
rororo (1994) S.151
|
|
Es
ist das aus der Institution selbst kommende Misstrauen, das die Abweichung
von der gesellschaftlichen Konvention als einen Sündenfall betrachtet,
hinter den nicht zurückzukehren ist. Wie das Punktekonto in Flensburg
oder das Vorstrafenregister bei Polizei und Meldeämtern ist die fürsorgliche
Begleitung durch die Institution eine Umwertung ihrer Selbstbegründung.
In ihr schreibt sie den Auftrag der Gesellschaft fort, macht ihre
Existenzangst und ihr Sicherheitsbedürfnis zur allgemeinen Angst
vor dem "wilden, regellosen" Kind, dem "unberechenbaren,
undurchsichtigen, gefährlichen" (Hesse, s.o.) Menschen, und zur Idee
früher, unausgesetzter Einforderung der Konventionalität. |

|
|
"Es
ist eine Tatsache", beklagt sich Flosdorf**,
"dass die Kinder und Jugendlichen erst sehr viel später in die Heime
kommen, - offensichtlich erst, wenn andere Möglichkeiten der Jugendhilfe
ausprobiert oder wenn das Aufschieben und Zuwarten die ohnehin angehobene
allgemeine Toleranzschwelle gegenüber Schwierigkeiten und
Normverletzungen endgültig überschritten hat". Dieser Satz wird im
Scheitern der Familie richtig. Wie weit aber will ich dieses durch die Fürsorge
definierte Scheitern vorziehen?
|
 |
Die Ansprüche der Gesellschaft an ihre
Mitglieder steigen unaufhörlich, sei es in Bildung, Wirtschaft oder
politischem System, - in der Enge der Grenzen wird ihr Überschreiten
unausweichlich. Wie mächtig muss der Orwell'sche Staat werden, um sie zu schützen, wie früh die
Konformierung durch die Institution einsetzen? Da das Gesamtsystem der
Gesellschaft aber nur in seinen Subsystemen Bestand hat, wird das Primat
der Familie mehr und mehr von den anonymen Strukturen der Fürsorge
usurpiert. Während die religiösen Ordnungen des Mittelalters sich noch
einmalig in Gott, die aufklärerischen Systeme abschließend in der
Vernunft gründen konnten, verlangen die gesellschaftsimmanenten Ethiken
der modernen transzendenz- und idealfreien Weltsicht nach programmatischem
Mitleid und unendlichem Regress von Sorge und Fürsorge. Hier und jetzt
geht es nicht mehr um eine zeitlose Moral, um letztgültige Werte und um
ein unverbrüchliches Menschsein in einem über es hinausweisenden
Menschenbild. Es geht um Macht! Es gilt, die Menschen in ihrer
Pseudosubjektivität zu isolieren, ihnen ihre Konditionen als
Konstruktionen gefällig zu machen. Wer dieses Bekenntnis verweigert, wird
ausgegrenzt und in der Ausgrenzung beherrscht.
|
|
|
Heim |
 |
|
|
|
* Erich Otto Graf
Institutionelle Einflüsse auf die
Funktionsweise von Erziehungsheimen
in: E. O. Graf (Hrsg.)
Heimerziehung unter der Lupe
Edition SZH (1993) S.143ff.
** Peter Flosdorf
Zukunft der Heimerziehung
in: P. Schmidle / H. Junge (Hrsg.)
Zukunft der Heimerziehung
Lambertus (1985) S.51 |
|
|
