|
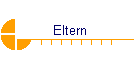
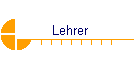

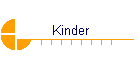
| |
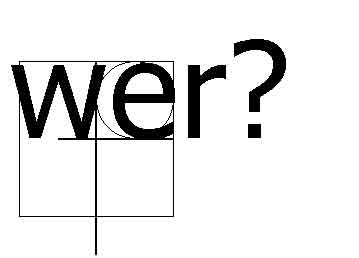 |
|
 |
Auf dieser Seite
erfahren Sie
mehr
über die Zielgruppen
des Verhaltenstrainings.
Sobald das Programm
vollständig ausgebaut ist,
wird es speziell auf Ihre
Situation angepasste Trainings für Eltern,
Lehrer, Professionals
(Ärzte / Therapeuten /
Erzieher) und Kinder
geben. |
Wer soll denn die Verhaltenstrainings
eigentlich besuchen?
|
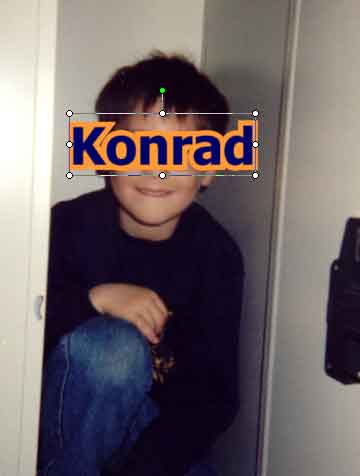
Christine Nöstlinger
Konrad -
oder das Kind aus der Konservenbüchse
Oetinger (1997) S.5f
|
Die Frau Bartolotti saß im
Schaukelstuhl und frühstückte. Sie trank vier Tassen Kaffee und aß drei
Brötchen mit Butter und Honig und zwei weiche Eier im Glas und eine
Scheibe Schwarzbrot mit Schinken und Käse und eine Scheibe Weißbrot mit
Gänseleberpastete. [...] Dann schleckte sie ihre honigverklebten Finger
ab. Und dann sprach sie zu sich: "Liebes Kind, jetzt wirst du
dich waschen und ordentlich bekleiden und an die Arbeit gehen, aber
hurtig!" Wenn Frau Bartolotti mit sich selber
sprach, sagte sie zu sich immer "liebes Kind". Seinerzeit,
als die Frau Bartolotti wirklich noch ein Kind gewesen war, hatte ihre
Mutter immer zu ihr gesagt: "Liebes Kind, nun mach doch die Aufgaben,
liebes Kind, nun trockne doch das Geschirr ab, liebes Kind, nun halt den
Mund!" Und später dann, als die Frau
Bartolotti schon kein Kind mehr war, da hatte ihr Mann, der Herr
Bartolotti, immer zu ihr gesagt: "Liebes Kind, nun koch doch
Mittagsessen, liebes Kind, nun näh doch einen Knopf an meine Hose, liebes
Kind, nun wisch doch den Boden auf!" Die Frau
Bartolotti war daran gewöhnt, Aufträge und Befehle nur dann
auszuführen, wenn jemand "liebes Kind" zu ihr sagte. Ihre
Mutter war längst gestorben und der Herr Bartolotti war längst
fortgezogen; warum, das geht keinen was an, das ist eine
Privatangelegenheit. Jedenfalls hatte die Frau Bartolotti niemanden außer
sich selber, der zu ihr "liebes Kind" sagte. |
Wie hätten Sie es denn gerne?
|
|
| Heute vertreten manche Erwachsenen eine Haltung,
die man vor 50 Jahren nicht verstanden hätte. Ausgerechnet im Wohlstand
unserer Industriegesellschaften mehren sich die Mitleidsbekundungen: Es
ist nicht leicht ein Kind zu sein!
Warum eigentlich nicht? Für viele Kinder ist heute doch gesorgt wie
nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Zig Millionen an Kindern sind
nicht nur satt, sondern überernährt. Viele Eltern arbeiten die meiste
Zeit für die Versorgung ihrer Kinder, um sich erst dann selbst etwas zu
gönnen, wenn die materiellen Ansprüche des Nachwuchses befriedigt sind.
Und wenn Kritiker einwerfen, dass Essen und Konsum doch nicht alles seien
- wann wurde denn in Euro und Cent mehr für die Betreuung unserer Kinder
ausgegeben, für Schulen und Jugendhilfe und Kliniken? Wer glaubt denn
wirklich daran, dass die Eltern früher mehr Zeit für ihre Kinder hatten,
als noch über 40 Stunden in der Woche und an Samstagen gearbeitet wurde;
als 90 Prozent der Bevölkerung nebenbei eine private Landwirtschaft
betrieben, weil der Lohn kaum für Essen und Kleidung ausreichte?! Die
"heile" Großfamilie, die sich um die Kinder kümmerte, war eine
Zweckgemeinschaft, die nicht selten allein aus existenzieller
Notwendigkeit zusammenhielt. In ihr waren die Kinder wohl bewahrt,
eingebunden in enge Strukturen. Sie mussten sich wenig Gedanken über die
Zukunft machen, welche die Ordnung der Gesellschaft weitgehend vorgab und
die bis ins Erwachsenenalter durch die Eltern bestimmt wurde. Kind blieb
man allenfalls bis zum Alter von 13 oder 14 Jahren, dann begann
die Ausbildung, die stets auch schon Arbeit war und die "Kinder"
häufig von ihren Familien trennte. Mag sein, dass Kind zu sein heute
nicht leicht ist - warum auch immer. Aber leichter war es für die Mehrheit
der Kinder nie.
Vielleicht hat sich in unserer Zeit für die Kinder dennoch eine neue
Schwierigkeit ergeben. Und vielleicht ist deren Grund gerade das, was das
Leben der Kinder leichter erscheinen lässt: die weiten Spielräume.
Mit Bedacht spricht der Volksmund von der "Qual der Wahl". In
der Philosophie gibt es das Bild des Buridanischen Esels, der
zwischen zwei Futtertrögen verhungert, weil er sich nicht entscheiden
kann, von welchem verlockenden Angebot er fressen soll. Auch wenn der
Namensgeber des Esels, der spätmittelalterliche Philosoph Johannes
Buridanus, das Gleichnis nicht erfunden hat - seine Philosophie dreht sich
tatsächlich vornehmlich um die Willensfreiheit des Menschen. Der Esel,
der im Paradies verhungert, ist ein drastisches, aber eindrückliches Bild
für einen Menschen, den die Freiheit seiner Entscheidung lähmt.
Wir Erwachsenen kennen dies in den kleinen und großen Fragen des Alltags
zu genüge: Was ziehe ich an? Was gibt es heute zu essen? Wohin fahren wir
in Urlaub? Wenn aber wir uns schon um solch simplen Antworten mühen,
obwohl wir die Alternativen vor Augen haben - um wie viel mehr quälen die
Entscheidungen über Freundschaft, Schule und Beruf unsere Kinder? Und
diese Qual ist in der Tat ein neues "Leid" der Kinder unserer
Tage.
|
Gunnar, Astrid, Stina und Ingegerd, so hießen die
Eriksonskinder auf Näs. Es war schön, dort Kind zu sein, und schön,
Kind von Samuel August und Hanna zu sein. Warum war es schön? Darüber
habe ich oft nachgedacht, und ich glaube, ich weiß es. Zweierlei hatten
wir, das unsere Kindheit zu dem gemacht hat, wie sie gewesen ist -
Geborgenheit und Freiheit. [...] Unsere Kindheit war ungewöhnlich frei
von Rügen und Schelte. Dass unsere Mutter nicht mit uns zankte, mag daran
gelegen haben, dass man ihr meistens gleich gehorchte, wenn sie etwas
anordnete. [...] Was einem aufgetragen war, das hatte man zu tun. Ich
glaube, es war eine nützliche Lehre, die einem später im Leben half,
auch mit eintöniger Arbeit ohne allzuviel Gestöhne und Gejammer fertig
zu werden. [...] "Reiß dich zusammen und mach weiter", wie oft
habe ich mir das nicht selber gesagt, wenn ich mich vor einer tristen
Arbeit drücken wollte, die fertig werden musste.
Astrid Lindgren
Das entschwundene Land
Oetinger (1977) S.33ff. |
Sich einmal nicht entscheiden müssen!
|
| Wie sehr der Zwang zur eigenen Entscheidung uns
belasten kann, das haben vor allem die Menschen aus der ehemaligen DDR
erfahren. Zwischen Steuerklärung, privaten Versicherungen und
zehnseitigen Kaufverträgen schwindet die Freude an der Freiheit. Sich
entscheiden zu müssen heißt nämlich auch, Verantwortung zu
übernehmen. Der Buridanische Esel verhungert ja nicht deshalb, weil
er beide Futtertröge haben kann, sondern weil er sich für einen
entscheiden muss; was gleich gut erscheint, zieht ihn gleich stark an. Wir
können aber in unserem Alltag nicht immer wissen, wie gut oder schlecht
eine Sache ist und ob es eine bessere Alternative gibt. Es macht uns
unsicher und ängstlich, uns für eine Zukunft zu entscheiden, die wir
nicht zuverlässig erkennen und einschätzen können. Deshalb träumen wir
manchmal davon, uns einfach hinzulegen und zu warten und zu schlafen, bis
der nächste Tag kommt, der unsere Probleme gelöst und unsere Sorgen
überflüssig gemacht haben wird. Oder wir warten unbewusst darauf, dass
ein anderer für uns die Entscheidung trifft. Wie Kinder, die Eltern,
Lehrer und Erzieher so lange provozieren, bis diese sie aus ihrer
Hilflosigkeit erlösen: bis man die Eltern nicht mehr enttäuschen kann,
weil sie keine Hoffnung mehr haben; bis man in der Schule nicht mehr
versagen kann, weil man rausgeflogen ist; bis man an den Lebensentwürfen
der Umwelt und den eigenen Ansprüchen nicht mehr scheitern kann, weil man
ganz unten angekommen ist.
Viele der modernen pädagogischen und psychologischen Untersuchungen
unseres Bildungs- und Gesundheitssystems sind Zeugen dieser Unsicherheit.
Natürlich macht es beispielsweise Sinn, die Schulreife eines Kindes vor
der Einschulung abzuschätzen - aber sind die Befunde der
Beratungsstellen, Psychologen und Ärzte denn tatsächlich bedeutsamer
für die Zukunft des Kindes als die Einschätzung der Eltern? Ist es
denn vernünftig anzunehmen, dass unsere Erfahrung als Erwachsene und die
"Vermessung" des Kindes durch Tests - also der Blick auf die
Vergangenheit, unsere Geschichte und die Geschichte des Kindes - uns einen
Einblick in die Zukunft gewähren? Vielleicht steht hinter diesem Bemühen
von Eltern und Fachleuten häufig die Angst, sich falsch zu entscheiden.
Und auch die Bitte, dass ein Testverfahren, eine Diagnose,
ein Attest, ein Gutachten feststellen möge, was aus dem
Kind werden soll. Sicherlich ist es uns nicht egal, was aus unseren
Kindern wird. Hinterher aber wollen wir sagen können, dass wir nichts
unversucht ließen, keinen Fachmann verschmähten und doch jeden Rat
zehnmal abwogen. Zuletzt haben wir auch noch das Kind gefragt, was es
möchte. Du hast Dich doch selbst dafür entschieden...
Sich einmal nicht entscheiden müssen, das ist ein Traum. Doch auch
nichts zu tun und abzuwarten ist eine Entscheidung. Wir Erwachsenen
können den Schritt zurück in Abhängigkeit und die Sorge anderer nicht
bewusst tun. Allerdings können wir unsere Kinder davor bewahren, mit
Entscheidungen überfordert zu sein. Viele Entscheidungen von Kindern
sind ohnehin Pseudoentscheidungen. Kann ein Kind wirklich beurteilen,
was es heißt, auf Hauptschule oder Gymnasium zu gehen? Möchten
Scheidungskinder entweder bei Mama oder bei Papa
leben - oder eben doch lieber bei beiden, wenn die Eltern sich nicht
streiten und Papa es nicht schlägt?! Verstehen Sie diese Einwände nicht
falsch: Es ist wichtig, dass bereits kleine Kinder gefragt und in
Entscheidungen mit einbezogen werden. Es kommt aber darauf an, die
richtigen Fragen zu stellen. Fragen, welche die Kinder verstehen und
beantworten können. Und nicht Fragen, die uns Erwachsene entlasten, weil
es scheinbar nach dem Willen der Kinder geht. Deshalb kann der erste
Ansatz zu einer Verbesserung der kindlichen Lebenssituation nur der Weg
über die Erwachsenen sein. Mag es auch das Verhalten des Kindes sein, das
sich ändern soll: das Verhaltenstraining brauchen zunächst die
Erwachsenen!
|
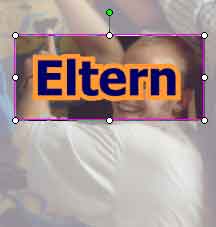
Eltern

Profis

Lehrer
|
|
Warum stehen die Kinder an letzter Stelle?
|
|
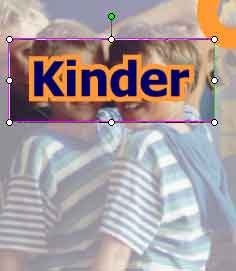
Kinder |
Verhaltensauffällige Kinder zu therapieren ist
ein guter Ansatz. Je früher das Verhalten des Kindes geprägt wird, desto
eher und dauerhafter sind die Veränderungen. Auch wenn wir Menschen mit
einer bestimmten Ausstattung an Sinnen und Leidenschaften geboren werden -
ihren Ausdruck in der Welt lernen wir in unserer Kindheit. Der Begriff von
Wut, Angst oder Trauer ist uns nicht angeboren. Menschen in unserer Umwelt
haben uns einst beigebracht: Jetzt bist Du aber wütend! Du
musst keine Angst haben! Weine ruhig, es ist in Ordnung, traurig zu sein! Aha,
das ist also Wut, was ich in meinem Bauch und meinem Kopf spüre; es ist
die Angst, die mich zittern lässt; es ist die Traurigkeit, die mir die
Tränen aus den Augen drückt. Deshalb ist es auch so wichtig, dass Kinder
auf eine verständnisvolle Weise lernen, wie die Affekte in ihrem Körper
mit den Emotionen in ihrem Kopf zusammenhängen. Ein Kind, das in einer
Welt schimpfender und schreiender Erwachsener aufwächst, wird Schimpfen
und Schreien für einen normalen Ausdruck von Wut halten, - oder gar nicht
mit dem Ärger der Eltern bzw. der eigenen Wut in Verbindung bringen, denn
so oft kann niemand richtig wütend sein, wie seine Eltern es anschreien.
Erfolgreiche Psychotherapie bei verhaltensauffälligen Kindern beinhaltet
neben Grenzsetzung vor allem Unterricht über Gefühle. Wer die eigenen
Gefühle nicht versteht und gezielt ausdrücken kann, der versteht auch
nicht Ärger, Traurigkeit und Schmerz seiner Mitmenschen.
|
| Krösa-Majas Gejammer über
Michels Trunkenheit hatte die Guttempler-Vereinigung in Bewegung gesetzt.
Und nun kamen sie und wollten mit Michels Mama und Papa reden. Es wäre
gut, meinten sie, wenn Michel zum Abendtreffen ins Guttemplerhaus käme
und dort zu einem nüchternen Leben bekehrt würde. Michels Mama platzte
fast vor Wut und erzählte, wie es mit Michel und den Kirchen gewesen war.
Aber die drei Guttempler sahen trotzdem sehr bekümmert drein und einer
von ihnen sagte: "Ja, aber man sieht doch schon, wohin das mit Michel
führt!" [...] Als der Abend kam, musste Michel seine Sonntagskleider
anziehen. Die Müsse setzte er auch auf. Er hatte nichts dagegen sich
bekehren zu lassen. Es konnte recht lustig werden, ein bisschen unter
Menschen zu kommen.
Astrid Lindgren
Immer dieser Michel
Oetinger (1988) S.295f. |
Als Arzt oder Psychologe oder Psychotherapeut
mit Kindern zu arbeiten, ist viel einfacher als die Arbeit mit
Erwachsenen. Ein erwachsener Patient sagt dem Therapeuten schon einmal
deutlich, dass die Therapie bislang nichts gebracht habe.
Natürlich kann man auch damit "professionell" umgehen und
äußere Faktoren jenseits der Therapie als Gründe anführen. Dennoch
bleibt die Niederlage haften, denn es ist eine Niederlage in direkter
Auseinandersetzung mit dem Patienten, dem man nicht helfen konnte. In der
Behandlung von Kindern, v.a. auch von verhaltensauffälligen Kindern, ist
der Auftraggeber in den seltensten Fällen das Kind selbst. Eltern, Lehrer
und Erzieher wollen, dass das Kind sich anders verhält. Wenn die Therapie
scheitert, kann man dem Kind noch immer mit Mitleid begegnen. Der Umwelt
des Kindes aber wird die Schuld am Scheitern der Behandlung zugeschoben,
denn das Kind ist durch die Erfahrungen der Vergangenheit zu gestört
und/oder die Familie nicht genügend zur Mitarbeit fähig. Das soll man
den Eltern jedoch zugleich nicht offen sagen, um den eigentlich bereits
aufgegebenen Rest an Elternarbeit nicht zu verlieren. Also schreibt man
nach langem hilflosem Bemühen irgendwann das Kind ab, beendet die
Therapie, empfiehlt am Ende vielleicht eine Herausnahme aus der Familie.
Für das Kind bleibt dieser Behandlungsversuch nur ein weiterer Beleg
dafür, dass die Erwachsenen ihm nicht helfen können oder wollen, es
letztlich aber vor allem in seinem Verhalten nicht besiegen werden.
Zwei Stunden Verhaltenstherapie in der Woche stehen 166 Stunden
gegenüber, in denen das Kind in einer anderen,
"nichttherapeutischen" Welt lebt. Meist in jener Welt, die es in
vielen Bereichen durchaus positiv geprägt hat, in der aber auch die
Auffälligkeit hervorgetreten ist. Allein diese simple Rechnung macht
deutlich, wie wenig aussichtsreich individuelle Therapien bei Störungen
sind, die in der Umwelt des Patienten eine bestimmte Funktion haben und
daher (zumindest für den "Gestörten") Sinn machen. Ein
besseres Stundenverhältnis erreicht man bei Kindern und Jugendlichen nur,
wenn man sie tagsüber, unter der Woche, für Monate oder Jahre aus ihrer
angestammten Umwelt herausnimmt: in Tagesstätten, Wochenheime, Kliniken
oder eine dauerhafte Fremdunterbringung. Oder aber, wenn es einem gelingen
würde, die Umwelt in einem für das Kind positiven Sinne zu
beeinflussen. Wenn Eltern, die niemals alles in der Erziehung ihrer
Kinder falsch machen können, nur ein wenig mehr noch richtig machen
würden. Wenn Lehrer etwas mehr Wissen über den Umgang mit
verhaltensauffälligen Kindern hätten, das sie mit ihrem großen
Engagement verbinden können. Wenn Erzieher in Kindergärten,
Tagesstätten oder Heimen sich trauen würden, mehr für die Kinder zu
entscheiden und Regeln konsequenter zu vertreten. Und wenn Ärzte und
Psychotherapeuten sich stärker in der Verantwortung für den Erfolg ihrer
Behandlung sehen würden. Für sie alle wird es Verhaltenstrainings von therapaed
geben, denn ihr Verhalten im Umgang mit dem Kind verändert mehr als ein
weiteres gutgemeintes Therapieprogramm für Kinder. Weil aber spielerisch
auch Kinder und Jugendliche noch etwas über sich erfahren können, wollen
wir das zu einem späteren Zeitpunkt in unser Angebot aufnehmen.
Entscheiden Sie sich als Erwachsene - die Kinder sind dieses Mal als
letzte dran. |
|

|
|
|
